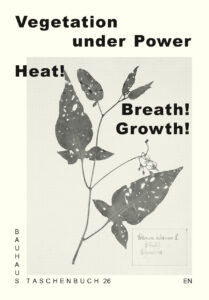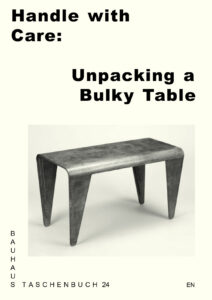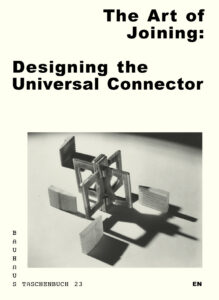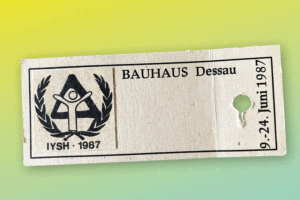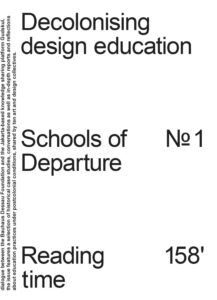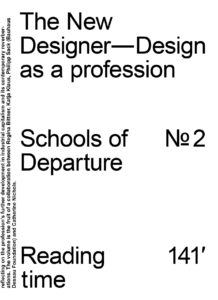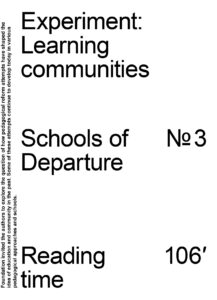Mit ihren Programmen bietet die Stiftung Bauhaus Dessau ein vielfältiges Angebot zur künstlerischen, wissenschaftlichen und forschenden Auseinandersetzung mit dem Erbe des Bauhauses in Dessau sowie zu Bildung und Vermittlung.
Bauhaus Lab
Das Bauhaus Lab ist ein experimentelles Format, bei dem das Erforschen und Herausstellen eines ausgewählten Gegenstands der Geschichte moderner Gestaltung miteinander verknüpft werden. Das im Zentrum des Programms stehende Objekt interessiert aufgrund seiner Thesenhaftigkeit: Die disziplinenübergreifende Auseinandersetzung mit seinen materiellen Gegebenheiten, historischen Verflechtungen, spekulativen Pfaden und geistigen Impulsen setzt der Eindeutigkeit der vorherrschenden Geschichtsschreibung der Moderne eine Vieldeutigkeit und Vielstimmigkeit von Möglichkeiten einer anders verlaufenen Vergangenheit und Gegenwart entgegen. Das dreimonatige postgraduale Programm richtet sich an junge Professionelle der Architektur, des Designs und der Ausstellungspraxis. Die als Ergebnis der Recherchen und Feldstudien gemeinsam erarbeiteten Ausstellungen und Publikationen leisten einen Beitrag zu einer alternativen kritischen Geschichtsschreibung der Bauhaus- und Modernegeschichte.
After modern brightness: Ecologies of light
Die Verbreitung von künstlichem Licht führte in der Zeit der Weimarer Republik zu radikal neuen gesellschaftlichen Vorstellungen über das Verhältnis von Tag und Nacht sowie Licht und Dunkelheit und wies der Dunkelheit einen Platz außerhalb dessen zu, was als modern und fortschrittlich galt.
Am Bauhaus wurde die Glühbirne selbst zum Vorbild für die Gestaltung von Beleuchtungskörpern; ihre technische Form galt als radikalster Ausdruck von Funktionalität. Das strahlende Glasgebäude war jedoch in eine globale Struktur von miteinander vernetzten Akteuren der Licht- und Elektrizitätsindustrie eingebettet, allen voran OSRAM und AEG. Ausgehend von Marianne Brandts klassischer Pendelleuchte mit einer Zweizonen-Glaskugel untersucht das Bauhaus Lab 2025 den elektrischen Strom von den Bakelit-Schaltern über die Kabel und Anschlüsse bis hin zu den Kraftwerken und Infrastrukturen der Stromversorgung. Das Programm beschäftigt sich mit der Frage, wie die Gestaltung zukünftiger Lichtverhältnisse aussehen könnte – eine Gestaltung, die dazu beiträgt, die mit der allgegenwärtigen Helligkeit einhergehende Lichtverschmutzung einzudämmen und die neue Möglichkeiten des Umgangs mit der Dunkelheit eröffnet.
Open Studios
Das Bauhaus gilt bis heute als einer der herausragenden Lernorte für künstlerische und gestalterische Bildung. Mit den Open Studios – Teaching Models knüpft die Stiftung Bauhaus Dessau an dieses pädagogische Erbe an. Studierende und Lehrende von Universitäten, Kunsthochschulen und Bildungsinitiativen sind in die historischen Werkstätten des Bauhauses eingeladen, um zeitgemäße Modelle gestalterischer Pädagogik zu entwickeln und anzuwenden. Die Themen bewegen sich dabei zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sie beziehen sich auf die Pädagog*innen des historischen Bauhauses und greifen aktuelle Debatten der Ausbildung von Gestalter*innen auf.
COOP Design Research – Master of Science
Was ist das Wissen der Gestaltung? Ist Entwerfen eine Praxis des Forschens? Und wie „betreiben“ Designer*innen Forschung?
Der einjährige COOP Design Research MSc integriert Design und Forschung als transdisziplinäre Felder an der Schnittstelle von Designanthropologie, Material Culture Studies, Architektur- und Designforschung, Geschichte und Theorie sowie den Sozialwissenschaften. Das Programm setzt sich kritisch mit aktuellen Fragestellungen der Design Studies und der Architekturforschung auseinander und knüpft dabei an die vielfältigen modernen Vermächtnisse des Bauhauses an. Ausgangspunkt ist die Befragung des Designs als klar definierte Disziplin ebenso wie die Reflexion der anthropozentrischen Vorstellung einer ausschließlich vom Menschen geschaffene Umwelt.
Study Rooms
Jahr für Jahr sind über hundert Menschen aus aller Welt direkt an den verschiedenen Bildungsprogrammen der Stiftung Bauhaus Dessau beteiligt: Die Bauhaus Study Rooms bieten den Absolvent:innen der Bauhausprogramme eine Möglichkeit der Vernetzung und richten sich gleichzeitig an eine interessierte lokale und internationale Öffentlichkeit. Sie schaffen temporäre transversale Lernräume, bei denen Bedingungen der kollektiven Wissensproduktion erforscht und erlebt werden können. In experimentellen Workshops, runden Tischen und Rundgängen werden aktuelle Fragestellungen der Stiftung aus der Sicht der verschiedenen Programme diskutiert.
Schulen des Aufbruchs – Ein digitaler Bauhausatlas zum Miteditieren
Welches Wissen benötigen Architekt*innen und Designer*innen? Wie haben sich weltweit Studiengänge, Berufsbilder und Curricula dazu entwickelt? Die Stiftung Bauhaus Dessau hat einen digitalen Atlas unter dem Titel „Schulen des Aufbruchs“ entwickelt, der Antworten auf diese Fragen sucht. Welche Rolle hier das Bauhaus und andere markante Schulexperimente spielen, spiegelt sich in dem Atlas in vielgestaltiger Form. In Kurzporträts, Bild-Essays, Fallstudien, historischen Filmsequenzen und Journal-Beiträgen werden reformorientierte pädagogische Konzepte zusammengetragen, die die Designausbildung in den letzten 100 Jahren auf der ganzen Welt geprägt haben.
Im Zuge einer einjährigen Projektförderung durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 und einer Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes entsteht dieser digitale Atlas seit 2022 als ein ständig wachsendes Netzwerk, das die Forschungen zu den globalen Wechselbeziehungen des Bauhauses mit anderen Reformprojekten in der Gestaltungslehre im 20. und 21. Jahrhundert zusammenführt. Statt vom „Einfluss“ und vom Bauhaus als „Zentrum“ mit Bewegung in die außereuropäische „Peripherie“ auszugehen, macht der Atlas vielfältige Verflechtungen und Parallelentwicklungen sichtbar.
Der digitale Atlas lebt vor allem von der Beteiligung der Nutzer*innen: In dem Online-Vermittlungsbereich „Notes“ wird die Möglichkeit gegeben, Inhalte zu editieren, Recherchen zu ergänzen und Datenmaterial aufzubereiten. Der digitale Atlas richtet sich sowohl an Studierende, Lehrende, Wissenschaftler*innen, Kurator*innen und Bauhausforscher*innen.
Zusätzlich wird im Atlas ein jährliches E-Journal gelauncht. Im Fokus der vierten Ausgabe des Journals „Maschinenlernen“ steht die Beziehung zwischen Designausbildung und Technologie. Der Glaube an Wissen, Technik und Fortschritt trat vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Form einer groß angelegten Kybernetisierungswelle in Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Erscheinung. Im Journal finden sich dazu historische und zeitgenössischen Beiträge über besonders technologieaffine Schulexperimente und Gestalter*innen und deren unterschiedliche Vorstellungen, die sie über Maschinen entwickelt haben.
Die E-Journale sind im Digitalen Atlas in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht und werden über den Verlag Spector Books Leipzig in einer Taschenbuchausgabe herausgegeben.
Das aktuelle 4. E-Journal zum Thema „Maschinenlernen in der Gestaltungslehre“ ist online verfügbar.